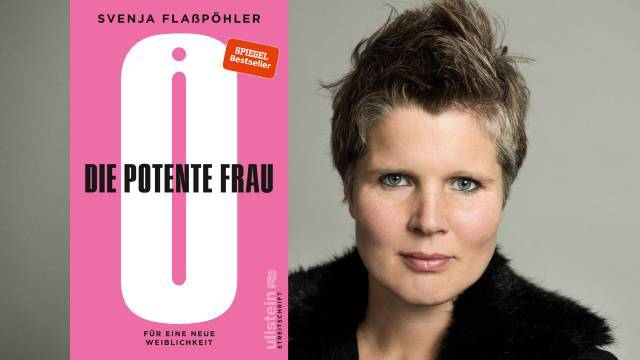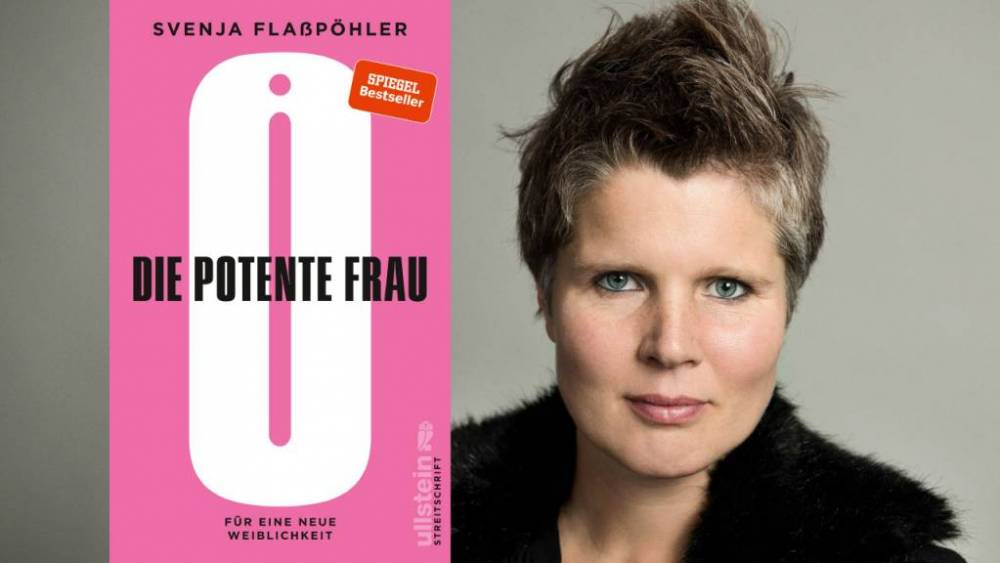Unbehagen gegenüber dem Hashtag-Feminismus, der mit der #MeToo-Kampagne gegenwärtig Medienhype ist, spüren auch viele Frauen. Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie Magazins hat in einem bemerkenswert schmalen Bändchen von 48 Seiten eine haarscharfe Kritik des Hauptstroms dieser Debatten geliefert. Ihr zentraler Punkt ist die Beobachtung, dass #MeToo, ein passives Opferbild der Frauen vermittelt und den Eindruck erweckt, als seien sie mit männlicher Gewalt in der Arbeitswelt, auf der Straße und im Bett nicht nur ständig konfrontiert, sondern ihr auch hoffnungslos ausgeliefert. Auch würden verschiedene Formen der Übergriffigkeit – von der Vergewaltigung bis zur verbalen Anmache – oft mit so empörendem Gestus behandelt als wären sie gleichermaßen schwerwiegend.
Für unannehmbar hält es Flaßpöhler, dass Männer, denen sexistische Übergriffe auf Frauen, andere Männer oder auch Minderjährige vorgeworfen werden, öffentlich angeprangert werden, ehe ein strafrechtliches Verfahren – soweit das überhaupt noch möglich ist – stattgefunden hat. Der Pranger habe seine Blütezeit im 13. Jahrhundert gehabt, erinnert Flaßpöhler: „Der Verurteilte wurde an einen Schandpfahl gefesselt, öffentlich vorgeführt und der gesellschaftlichen Schmähung preisgegeben. Wer einmal am Pranger stand, konnte nicht mehr so weiterleben wie zuvor, er war als gesellschaftliches Subjekt vernichtet.“ Wie der Beginn des Zitats ausweist, wurde man selbst im 13. Jahrhundert – anders als jetzt – zuerst nach damaligem Recht verurteilt und dann erst an den Pranger gezerrt. Heute, so Flaßpöhler, „übernimmt die Funktion des Schandpfahls der Hashtag (so Klarnamen genannt werden) oder auch die sogenannte Verdachtsberichterstattung,“ die die Unschuldsvermutung meist außen vor lässt. Rechtsstaat adé!
Flaßpöhler meint, dass sich Frauen gegenüber etlichen Formen von Anmache oder Übergriffen durchaus erfolgreich wehren können. Und auch in den jetzt medial hochgepuschten Altfällen, die schon Jahrzehnte zurückliegen, wäre auf jeden Fall eine Anzeige möglich gewesen. Manchmal kommt zur Sprache, dass eine Anzeige unterlassen wurde, weil frau sich in ökonomischer Abhängigkeit von dem übergriffigen Mann gefühlt hätte. Damit kommt man dem eigentlichen Problem schon näher: sexuelle Übergriffe haben nicht nur mit zum Teil vermeintlicher, zum Teil realer körperlicher Überlegenheit von Männern zu tun, sondern vor allem mit ihrer ökonomischen Macht. Flaßpöhler stellt richtig fest, dass ein Hashtag zum Thema ´ungleiche Löhne für gleiche Arbeit` weitaus weniger Chancen hat, vom gegenwärtigen Medienmarkt gehypt zu werden als Berichte von sexuellen Übergriffen, insbesondere, wenn es sich um prominente männliche Täter und/oder prominente Opfer handelt. Hier hätte es dem vorbildlich schlanken Büchlein gut getan, wenn Flaßpöhler auf einigen zusätzlichen Seiten erläutert hätte, dass die große Mehrheit der Frauen auf Grund viel größerer ökonomischer Abhängigkeiten als sie etwa in der Filmbranche existieren, nicht nur von Seiten des Arbeitgebers, sondern auch des Partners – oft schlimmeren und permanenten sexuellen Übergriffen ausgeliefert sind. Nicht zu reden von den Millionen Zwangsprostituierten – deren bloße Existenz zeigt, wie stark das Patriarchat noch die Welt beherrscht.
Dass die #MeToo-Kampagne die alte essentialistische Sicht auf die Geschlechter fortschreibt, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass selbst die verbale Denunziation lang zurückliegender sexueller Übergriffe als „grandioser emanzipatorischer Akt“ gefeiert wird. Sehr richtig ist Flaßpöhlers Beobachtung, dass die konservative Auffassung der Frau nur zwei Handlungsmöglichkeiten bietet: sie muss den Mann abwehren, möglichst ehe es zu Vertraulichkeiten kommen kann – oder versuchen, „ihm bis zur Selbstaufgabe zu gefallen“. Eigene Bedürfnisse kommen da bestenfalls indirekt vor. Hier erlaubt sich die Rezensentin die Bemerkung, dass das Risiko, in dieser Rolle zu verbleiben, nicht nur auf einen großen Teil der noch herrschenden Geschlechterverhältnisse zu beziehen ist, sondern gerade auch auf die Filmbranche, deren Produktionen meist üble patriarchale Wunschbilder von Frauen ausstellt.
Dass es überhaupt zu einer Medienhype mit einem rückwärtsgewandten Frauenbild kommen kann, ist für Flaßpöhler ein Zeichen, dass fortgeschrittenere Konzepte der feministischen Theorie zum Teil vergessen, zum Teil aber auch nicht wirkten. Judith Butler hätte zwar richtig herausgestellt, dass die Geschlechteridentitäten biologisch flexibel sind und sozial fixiert werden. Sie wollte der Diskriminierung von Frauen entgegenwirken, die keine Kinder haben können oder wollen und queeres Körperbewusstsein stärken. In der Rezeption von Butlers Werk wurde aber die Problematik der heterosexuellen Verhältnisse – die ja die Mehrheit der heutigen Menschen betrifft – nicht mehr ausreichend diskutiert. Flaßpöhler empfiehlt die Rückbesinnung auf auf Luce Irigaray und Hélène Cixous, die zur umfassenden Stärkung der aktiven Subjektivität aufriefen, unabhängig vom Lebensmodell der Frau – oder wie auch immer Menschen sich definieren, die nicht dem herrschenden Patriarchat angehören.
Genau das ist auch Flaßpöhlers Ziel, wobei sie nicht nur selbstbewusstes Auftreten in der Arbeitswelt meint, sondern ebenso in der Sexualität. Frauen sollen endlich ihre sexuelle Lust nicht mehr verleugnen, versteckt oder verschämt ausleben, sondern ebenso offensiv wie die Männer: „Wir brauchen zwei potente Geschlechter, die sich in Fülle begegnen.“
Da es unmöglich ist, eine Grenze zwischen Flirt und Übergriffigkeit zu ziehen – eine von einem Menschen ausgehende sexuelle Projektion auf einen anderen Menschen kann nicht nur unerwünscht sondern auch erwünscht sein oder, einmal inspiriert, wünschbar werden – hält Flaßpöhler die gesetzliche Einhegung von Situationen wie sie aus dem Hastag #nein-heißt-nein hervorging, für problematisch. Selbstverständlich, sagt sie, gehören Vergewaltiger hinter Gitter, aber prinzipiell weise ein so weitgehender Schutz von Frauen auf das alte, infantile Bild vom schwachen Geschlecht, schreibe es sogar fort. „Im 21. Jahrhundert sollten sich Frauen nicht nur auf die schützende Hand von Vater Staat verlassen, sondern haben, um es mit Kant zu sagen, auch eine ´Pflicht gegen sich selbst`.“ Auch Frauen müssen sich „aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“ befreien und „die ihnen durch jahrhundertelangen Emanzipationskampf bereitgestellte Möglichkeit zu einer selbstbestimmten Existenz willentlich ergreifen oder dies zumindest ernsthaft versuchen“.
Eine sympathische, aber auch kühne Position, denn die Ausgangssituation, um offensiv das Recht nicht nur auf sexuelle Selbstbestimmung, sondern auch auf die eigene Lust einzufordern, ist für Frauen sehr unterschiedlich. Und es ist diskutabel, ob es ausreicht, wie Flaßpöhler vorschlägt, die unabhängigen Frauen aufzurufen, solidarisch mit allen zu sein, die sich noch nicht aktiv verteidigen und für sich selbst einsetzen können.
Svenja Flaßpöhler: Die potente Frau. Für eine neue Weiblichkeit, Ullstein, Berlin 2018, 8,00 Euro, 48 S.
* Der Text erschien, leicht gekürzt, unter dem Titel ´Toxische Opferrolle?` am 8. Juni 2018 in der Jungen Welt.